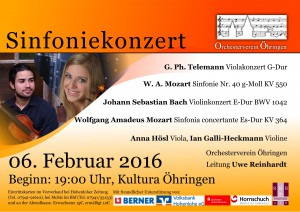Programm:
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Ouvertüre zu Idomeneo KV 366
Franz Schubert (1797 – 1828)
Sinfonie h-moll D759 (Unvollendete)
1. Allegro moderato 2. Andante con moto
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur op. 73
Allegro – Adagio un poco mosso – Rondo: Allegro ma non troppo
Solist: Sven Bauer
Leitung: Uwe Reinhardt
Eintrittskarten im Vorverkauf bei Hohenlohesche Buchhandlung Rau (MUSIC-STORE, Tel. 07941-92770) und an der Abendkasse.
Erwachsene 12€, ermäßigt 6€, Kinder bis 14 Jahre frei.
Mit freundlicher Unterstützung von





Sven Bauer

Sven Bauer wurde 1989 in Schwäbisch Hall geboren und erhielt dort als Siebenjähriger seinen ersten Klavierunterricht an der Musikschule bei Alla Schuljakowski.
Seit seinem neunten Lebensjahr nimmt Sven Bauer sehr erfolgreich an Wettbewerben teil und wurde vielfach Preisträger u. a. bei „Jugend Musiziert“ auf Bundesebene. Des Weiteren erhielt er ein Stipendium sowie den Publikumspreis der Internationalen Klavierakademie Murrhardt. 2009 gewann er den Grand Prix des International competition – festival „Music without limits“ in Druskininkai, Litauen.
Auch auf dem Gebiet der Kammermusik ist Sven Bauer aktiv: 2010 folgte der Gewinn des Kammermusikwettbewerbs der Polytechnischen Gesellschaft e.V. sowie des Bad Homburger Förderpreises für Kammermusik. Im Mai vergangenen Jahres debütierte Sven Bauer im Rahmen der Sendung „Hörprobe“ auf Deutschlandradio Kultur.
Das Debüt als Solist mit Orchester gab Sven Bauer mit zwölf Jahren, das erste Recital folgte 2004. Besondere Aufmerksamkeit erregte er mit Chopins Klavierkonzert Nr. 1 im selben Jahr: „Seine Konzentrationsfähigkeit, seine Souveränität, seine Virtuosität und seine Musikalität sind für einen 15-jährigen absolut außergewöhnlich.“ Haller Tagblatt, 08.12.2004, Monika Everling.
Sven Bauer besuchte während seiner Schulausbildung am Gymnasium bei St. Michael zahlreiche Meisterkurse und konnte durch Begegnungen mit renommierten Professoren und Pianisten wie Lev Natochenny, Igor Lazko, Andrzej Jasinski, Oxana Yablonskaya, Karl-Heinz Kämmerling und Jacques Rouvier, die ihm allesamt eine hohe musikalische Begabung bescheinigten, die eigene künstlerische Arbeit entwickeln und sein Interesse an der Musik formulieren.
Im Herbst 2005 wurde Sven Bauer Jungstudent an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt/Main und erhielt Unterricht bei Guoda Gedvilaite und Prof. Lev Natochenny. Seit März 2009 ist er Student der Meisterklasse von Prof. Lev Natochenny.
Zum Programm:
Im Sommer 1780 erhielt der vierundzwanzigjährige Mozart den Auftrag, für den Münchner Karneval 1781 eine große Oper zu verfassen. Zu dieser Zeit befand er sich wohl in einer der glücklichsten und erfolgreichsten Perioden seines kurzen Lebens überhaupt. Und auch die aufführungstechnischen Voraussetzungen in München waren denkbar gut, da der Ende 1778 von Mannheim nach München übergesiedelte Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz seine schon damals weltberühmte Theatertruppe, Sänger und Orchester praktisch komplett in die Bayerische Metropole mitgenommen hatte.– Wenn, wie heute Abend, von dem Gesamtwerk nur die Ouvertüre erklingt, wird der Blick auf die grandiose Musik des Idomeneo nicht durch die sperrige Hülle der Opera-seria-Konventionen und den grauenvollen Konflikt der Handlung verstellt: Für den Fall seiner Rettung aus Seenot verspricht Idomeneo dem Gott Poseidon den ersten Menschen zu opfern, den er am Strand trifft. Doch jener Mensch, den Idomeneo nach seiner Rettung zuerst erblickt, ist ausgerechnet Idamante, sein Sohn. – Wird der Vater seinen Sohn tatsächlich für Poseidon töten? Oder findet sich einen Ausweg…?
Mozart stellt diese bange Frage am Ende der Ouvertüre in musikalisch genialer Form und lässt die Antwort offen.
Der erste Satz der Sinfonie in h-moll von Franz Schubert scheint am tragischen Ausgang des Konfliktes keinen Zweifel zu lassen. Eines Konfliktes, der freilich von Schubert allgemeingültig und viel umfassender gestaltet wird, der gleichsam die Summe aller schmerzhaften Erfahrungen in sich schließt. Schubert war ein viel zu großer Künstler, um das Persönliche nicht als Teil und als Spiegel des Allgemeinen zu begreifen. Je älter und erfahrener er wurde, umso mehr sah er sich konfrontiert mit der Unversöhnlichkeit und Unlösbarkeit des Widerspruchs zwischen Kunst und Leben, zwischen Wahrheit und bürgerlicher Wirklichkeit. Auf dem Gebiet der Kammermusik und vor allem in seinem Liedschaffen hatte sich diese Entwicklung weg von einem Komponisten heiterer Frühklassik, der die Musik v.a. um einen unverwechselbaren Wienerischen Zug und Rossinische Raffinessen poetisch verfeinerte, längst angebahnt; mit der Unvollendeten vollzieht Schubert diesen Schritt nun auch in seinem orchestralen Werk.
Ich bin ein Künstler. Ich! Ich bin Schubert, Franz Schubert, den alle Welt kennt und nennt! Der Großes gemacht hat und Schönes, das ihr gar nicht begreift!
Wer so zu den Mitgliedern der Hofoper spricht, der konnte, wenn er es nur gewollt hätte, zu den beiden Sätzen dieser Sinfonie auch einen dritten und einen vierten hinzukomponieren. Dass er es nicht tat, bestärkt uns in unserem Empfinden, dass in diesen zwei Sätzen Musik in vollendetster Form vorliegt, die einer Ergänzung nicht bedarf. Nicht von ungefähr handelt es sich bei der Unvollendeten um die meistgespielte Sinfonie überhaupt.
Vieles spricht dafür, dass Arnold Schering recht hat mit der These, dass die Programmatik dieser Sinfonie in der gleichen tragischen Lebenserfahrung wurzelt, die Franz Schubert in einem Prosastück, seiner Traumerzählung, mit eigenen Worten ausgesprochen hat: Wollt ich Liebe singen, ward sie mir zum Schmerz. Und wollte ich Schmerz singen, ward er mir zur Liebe. So zerteilte mich die Liebe und der Schmerz.
Bereits mit dem Hauptthema des ersten Satzes, einem Sinnbild des Grabes und der Todessehnsucht, unisonso von den tiefen Streichern vorgetragen, wird dieser Leitgedanke in seiner ganzen Tragik laut. Über einer ruhelos getriebenen Streicherfigur und dunkel pochenden Bässen erhebt sich danach ein schmerzlicher Klagegesang der Oboen und Klarinetten, der sich zu immer heftigeren Akzenten steigert, bis ihm mit einem Schlag ein Ende gesetzt wird. Ein Hornruf, eine sanfte Modulation, und der Schmerz verwandelt sich in Liebe. Die jetzt folgende Ländlermelodie ist eine der wunderbarsten musikalischen Tonschöpfungen überhaupt. Alles Herzliche, Warme, Unverbildete, Volkshafte, alles, was Schubert bedrängt und tödlich bedroht schien, hat er in sie hineingelegt. Und in der Tat: Dieser Gefahr verleiht er alsbald eine vernichtende Gestalt in brutalen Fortissimoschlägen des Orchesters, die die gesamte Liedepisode zu zerreißen drohen. Aber die hoffnungsfrohe Melodie kann sich durchsetzen; musikalisch-motivische Kompositionstechnik in allerhöchster Vollendung. Doch dann, nach der Wiederholung der Exposition, zu Beginn der Durchführung, versinken die Bässe in bodenlose Tiefe, das Grab öffnet seinen Rachen, dem dreimal ausgestoßenen Aufschrei des Entsetzens folgen die beklommenen Herzschläge der in Synkopen erstarrenden Holzbläser. Abermals erscheint das Todessehnsuchtsmotiv des Anfangs, jetzt aber verwandelt in die ehernen Schritte eines heroischen Kampfthemas und es folgt eine musikalische Schlacht auf Leben und Tod, eine Zusammenballung aller Energien zur letzten kämpferischen Auflehnung. Über den tragischen Ausgang bleibt kein Zweifel, der Schmerz scheint den Sieg über die Liebe davonzutragen.
Der zweite Satz Andante con moto ist diesen Kämpfen entrückt. Tiefer Märchenfriede umfängt uns. Behutsam steigen Bassschritte auf und nieder, leise gezupft und dann wieder weich gestrichen, unermüdlich die stille Bewegung in Gang haltend. Darüber erklingt eine friedvolle, sanfte Kantilene. Halb Ländler, halb Wallfahrtsgesang, der sich allmählich durchsetzt und hinführt zu einem Posaunenchoral. Doch der sanfte Himmelsfrieden bleibt nicht ungestört, in einer großartigen Klageszene werden die Holzbläser durch einen Irrgarten von Modulationen geschickt, traumverlorene Frage-Antwort-Spiele, kanonische Zwiegesänge, Verwandlungen von Liebe und Schmerz auf engstem Raum, erst die Coda bringt endgültige Besänftigung.
So ist auch der zweite Satz nicht frei von dem tragischen Konflikt, der dem ersten seine Größe verleiht. Nur wird er hier in einer entrückteren Sphäre ausgetragen. Dort der gescheiterte Versuch, die Kräfte des Lebens, die Liebe vor der Zerstörung, vor den Kräften des Todes zu schützen. Hier das Bemühen, den inneren Frieden vor dem Einbruch des Schmerzes und der Verzweiflung zu bewahren.
Im 5. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven kommt die befreiende Lösung wie ein Deus ex Machina. In strahlendem Es-Dur komponiert ist es zweifellos Beethovens gewaltigstes Instrumentalkonzert, an Ausdehnung und Ausdrucksweite alles Frühere auf diesem Gebiet übertreffend, Vorbild für das große Virtuosen- und Ideenkonzert Lisztscher und Brahmsscher Prägung. Neuartig ist der Beginn mit einer großen Klavierimprovisation, die der üblichen orchestralen Exposition vorangestellt ist. Die fast 600 Takte dieses Allegros – erst im Takt 111 setzt das Klavier mit dem Haupthema ein – durchlaufen manche Differenzierungen, feinste Dur- und Molltönungen, um doch immer wieder zum großen heroischen Bogen des Anfangs zurückzufinden. Nach der Kadenz schwelgen Solist und Orchester noch lange im heroischen Es-Dur. Ihm wird im Adagio un poco moto ein stiller H-Dur-Gesang entgegengestellt, der an Innigkeit des Streicherklangs und ätherischer Leichtigkeit der Klavierfiorituren in ihrem zarten Ineinander keinen Vergleich kennt. Mit einem leisen Vorklang des Rondothemas trennt sich der Komponist von diesem schönen Intermezzo, um sich im Finalallegro von der brillantesten Seite zu zeigen, voll rhythmischer Eleganz, spritziger Dreiklangsthematik, mächtiger motivischer Steigerungen und freundlich-humorigen Spiels. Überraschende Tonartrückungen fehlen nicht, typisch rondomäßige Gebilde schalten sich ein, ein geheimnisvoller Paukenorgelpunkt begleitet das Verdämmern des Soloinstruments kurz vor dem tosenden Abschluß. Ein Werk wahrhaft olympischer Laune, nicht zufällig Beethovens Schlußstück des gesamten Konzertwerkes.
 Die in Pegnitz geborene Bratschistin Anna Hösl erhielt ihren ersten Geigenunterricht im Alter von sechs Jahren. In den darauffolgenden Jahren folgten mehrere Preise bei „Jugend musiziert“. Nach dem Abitur am Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium in Bayreuth studierte sie zuerst Violine IGP an der Kunstuniversität in Graz bei Prof. Anke Schittenhelm, bevor sie zur Viola wechselte. Von 2012 bis 2014 studierte sie bei Fabio Marano an der Hochschule für Musik in Karlsruhe, wo sie erfolgreich ihren Bachelorabschluss absolvierte. 2014 wurde sie in die Konzertfachklasse von Prof. Thomas Selditz an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien aufgenommen. Sie wirkte in zahlreichen Orchesterprojekten mit, unter anderem im Festspielhaus Baden Baden mit dem Nederlands Dans Theater, beim Festival junger Künstler Bayreuth, im Jungen Tonkünstlerorchester, Young Generation Orchester, dem Norddeutschen Symphonieorchester und war stellvertretendeStimmführerin im Webern Symphonie Orchester Wien. Mit dem 2012 gegründeten Streichtrio Arcata gibt sie unter anderem im Rahmen der Yehudi Menuhin Stiftung „Live Music Now“ Konzerte. Konzertreisen und Orchestertourneen führten sie in Länder wie den Libanon, die Ukraine und nach China. Wichtige musikalische Impulse erhielt sie in Meisterkursen bei Prof. Anke Schittenhelm, Fabio Marano und Prof. Hariolf Schlichtig.
Die in Pegnitz geborene Bratschistin Anna Hösl erhielt ihren ersten Geigenunterricht im Alter von sechs Jahren. In den darauffolgenden Jahren folgten mehrere Preise bei „Jugend musiziert“. Nach dem Abitur am Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium in Bayreuth studierte sie zuerst Violine IGP an der Kunstuniversität in Graz bei Prof. Anke Schittenhelm, bevor sie zur Viola wechselte. Von 2012 bis 2014 studierte sie bei Fabio Marano an der Hochschule für Musik in Karlsruhe, wo sie erfolgreich ihren Bachelorabschluss absolvierte. 2014 wurde sie in die Konzertfachklasse von Prof. Thomas Selditz an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien aufgenommen. Sie wirkte in zahlreichen Orchesterprojekten mit, unter anderem im Festspielhaus Baden Baden mit dem Nederlands Dans Theater, beim Festival junger Künstler Bayreuth, im Jungen Tonkünstlerorchester, Young Generation Orchester, dem Norddeutschen Symphonieorchester und war stellvertretendeStimmführerin im Webern Symphonie Orchester Wien. Mit dem 2012 gegründeten Streichtrio Arcata gibt sie unter anderem im Rahmen der Yehudi Menuhin Stiftung „Live Music Now“ Konzerte. Konzertreisen und Orchestertourneen führten sie in Länder wie den Libanon, die Ukraine und nach China. Wichtige musikalische Impulse erhielt sie in Meisterkursen bei Prof. Anke Schittenhelm, Fabio Marano und Prof. Hariolf Schlichtig. Ian Galli-Heckmann erhielt seinen ersten Violinunterricht nach der Suzukimethode in seiner Heimatstadt Paris. Im Alter von 6 Jahren wurde er von dem russischen Solisten Joseph Rissin entdeckt und zu seinem Pariser Kollegen Nejmi Succari empfohlen. Unter seiner Leitung belegte er schon sehr früh Erfolge in nationalen und internationalen Wettbewerben. Nach seinem Abitur, das er an der Purcell School of Music London absolvierte, studierte er als Foundation Scholar am Royal College of Music in London unter Yossi Zivoni und Ani Schnach, später an der Hochschule für Musik Karlsruhe bei L. Breuninger. Derzeit schliesst er sein Masterstudium an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig unter Kathrin ten Hagen ab. Über die Jahre war er als Orchestermusiker sowie Solist vielseitig aktiv mit Auftritten in Frankreich, Deutschland, England, Schweiz, Polen, Italien, Lichtenstein.
Ian Galli-Heckmann erhielt seinen ersten Violinunterricht nach der Suzukimethode in seiner Heimatstadt Paris. Im Alter von 6 Jahren wurde er von dem russischen Solisten Joseph Rissin entdeckt und zu seinem Pariser Kollegen Nejmi Succari empfohlen. Unter seiner Leitung belegte er schon sehr früh Erfolge in nationalen und internationalen Wettbewerben. Nach seinem Abitur, das er an der Purcell School of Music London absolvierte, studierte er als Foundation Scholar am Royal College of Music in London unter Yossi Zivoni und Ani Schnach, später an der Hochschule für Musik Karlsruhe bei L. Breuninger. Derzeit schliesst er sein Masterstudium an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig unter Kathrin ten Hagen ab. Über die Jahre war er als Orchestermusiker sowie Solist vielseitig aktiv mit Auftritten in Frankreich, Deutschland, England, Schweiz, Polen, Italien, Lichtenstein.