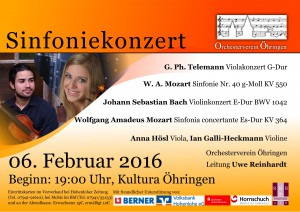SINFONIEKONZERT
ORCHESTERVEREIN ÖHRINGEN
Samstag, 25. April 2015, 19 Uhr
Kultura Öhringen
Programm
Pietro Mascagni (1863 – 1945)
Cavalleria rusticana – Intermezzo Sinfonico
Clara Schumann (1819 – 1896)
Konzert für Klavier und Orchester a-moll op. 7
Allegro maestoso – Romanze – Allegro non troppo
Pause
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Sinfonie Nr. 6 F-Dur op.68 (Pastorale)
Allegro ma non troppo (Erwachen heiterer Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande)
Andante molto mosso (Szene am Bach)
Allegro (Lustiges Zusammensein der Landleute)
Allegro (Gewitter und Sturm)
Allegretto (Hirtengesang – Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm)
Solistin: Lisa Wellisch, Klavier
Leitung: Uwe Reinhardt
Ostermorgen in einem sizilianischen Dorf. Der Platz vor der Kirche ist für einige Minuten leer. Das Intermezzo Sinfonico des Orchesters symbolisiert den Festtagsfrieden der frommen Kirchgänger und kündigt doch zugleich auf unnachahmliche Weise die Katastrophe an.
Cavalleria rusticana erzählt die uralte Geschichte von Liebe, verletzter Ehre, Betrug, unerwiderten Gefühlen, Neid, Hass und Missgunst. Die Liebe zwischen Santuzza und Turiddu verwandelt sich durch Missverständnisse und Intrigen in leidenschaftlichen Hass. Turiddu, der inzwischen nur noch Augen für Lola, die Frau von Alfio hat, wird von Santuzza deshalb am Tag der Heiligen Messe zur Rede gestellt. Turiddu ignoriert dies und eilt Lola in die Kirche nach.
Das Intermezzo steht zwischen dieser Konfrontation und den nachfolgenden Ereignissen in einem Wirtshaus, in der Alfio und Turiddu aufeinanderstoßen und sich zum Schluss duellieren, wobei Turiddu dem Kontrahenten unterlegen ist und stirbt.
Pietro Mascagni nahm 1889 mit Cavalleria rusticana an einem Einakter-Opernwettbewerb des italienischen Musikverlegers Sonzogno teil. Die Oper erhielt den ersten Preis und wurde bei ihrer Uraufführung im Jahr darauf einer der größten Erfolge der Musikgeschichte. Sie machte ihren Komponisten über Nacht reich und berühmt und zum Star der italienischen Opernszene, blieb jedoch für das große Publikum und die Nachwelt der unerreichte Geniestreich eines jungen Mannes, der an diesen Erfolg nie wieder anknüpfen konnte.
Die ersten Skizzen zu einem Klavierkonzert in a-Moll, des einzigen erhaltenen Orchesterwerks von Clara Wieck, stammen aus dem Jahre 1833, als sie vierzehn war und sich in Robert Schumann verliebte, der seit 1830 im Hause Wieck lebte und studierte. Ihr Vater, ein berühmter Klavierpädagoge, schreibt in jenen Tagen an seine Frau:
Clara ist jetzt sehr oft so unbesonnen, herrisch, voller unvernünftigem Widerspruch, nachlässig, im höchsten Grade unfolgsam, grob, eckig, ungeschliffen, ungeheuer faul, eigensinnig eitel auf Lumpen (an andere Eitelkeit ist gar nicht mehr zu denken, denn sie hat nicht das geringste Interesse mehr für die Kunst, und Zeit zum Studieren gar nicht, da sie erst um 9 Uhr aufsteht, halb 11 Uhr fertig ist, dann Besuche kommen, Mittag zu Tische gebeten ist und nachmittags aufs höchste unglücklich ist, wenn sie spielen soll, weil sie dann nur an das Theater denkt und an die Herren) kurz, was aus ihr werden soll, weiß Gott – zu Hause bleiben kann sie auch nicht. Den letzten Rest meines Lebens ärgere ich mich ab, und selten kann ich mich über sie freuen – ohne Betrübnis. Es vergeht kein Tag, wo sie mich nicht durch obige Eigenschaften kränkt. Wenn ich nicht wäre, würde sie kein einziges Stück vollendet spielen – denn sie ist so zerstreut, dass sie in der Regel nicht weiß, ob sie spielt, und der Eigensinn dabei verzerrt ihr Gesicht.
Vater Wieck bestrafte solchen Ungehorsam seiner bildhübschen und temperamentvollen Tochter beispielsweise damit, dass er ihr die Noten von schönen Stücken entzog, so dass sie „minderwertiges Zeug“ üben musste. Da lag es nahe, dass Clara, die schon als Teenager eine weltberühmte Pianistin war, sich selbst im Komponieren versuchte. Ihr Freund Robert kümmerte sich um die Orchestrierung. Heraus kam eine aparte Mischung aus Wieck, Schumann und Liszt, die zu Unrecht sehr selten auf Konzertprogrammen steht. Die Uraufführung des Werkes fand im November 1835 im Leipziger Gewandhaus unter der Leitung von Felix Mendelssohn mit Clara als Solistin statt.
Beethovens 6. Sinfonie entstand parallel zur Schicksalssinfonie, der Fünften, und beide wurden im gleichen Konzert, einer Musikalischen Akademie am 22. Dezember 1808 in Wien, uraufgeführt. Der Komponist selbst gab ihr den Titel Sinfonia pastorale und vollzog in ihr die Synthese zwischen programmatischer Naturschilderung und klassischer Sinfonie auf geradezu ideale Weise. Die deutschen Satzüberschriften sollen nach Beethovens Vorstellung nicht pedantisch ausgedeutet werden, sondern als Empfindung verstanden sein. In der gesamten Sinfonie ist die Freude an den Naturschönheiten ungetrübt. Hinzu kommt die Verwendung kroatischer Volksweisen und Tanzrhythmen, die vom zögernden Beginn bis zum stampfenden Jubel und kraftvollen Ländlertanz der ganzen Dorfgemeinschaft gesteigert werden. Humorvoll parodiert Beethoven das Spiel armer, übermüdeter Dorfmusikanten, wie er es so oft selbst erlebte. Der Oboist verpasst den Einsatz und kommt mit seiner dadurch synkopierten Melodiestimme zu spät. Auch der Fagottist hat verschlafen und bläst erst nach langer Pause und in großen Abständen seine einfachen Basstöne. Aber solche Unfertigkeiten erhöhen nur den Spaß, zumal am Ende doch alles klappt. Besonders eindrucksvoll gestaltet sich das plötzlich aufkommende Unwetter, die hastig schutzsuchende Menge und das Losbrechen der Elemente mit Sturm, Blitz und Donner. Mit genial einfachen Mitteln und höchster Meisterschaft der Instrumentation schildert Beethoven das Wüten der Naturkräfte. Dann verflüchtigt sich, so plötzlich wie es kam, das Sommergewitter. Noch ein ferner Blitz und verhaltenes Grollen in Pauken und Bässen. Der Reinigungsprozess der Natur ist abgeschlossen. Das hastige Eingangsthema erklingt nun abgewandelt in hohen Noten als beruhigende choralartige Melodie. Ein emporsteigender Lauf der Flöte leitet zum abschließenden fünften Satz über, dem Hirtengesang. Die Solo-Klarinette stimmt die schlichte schalmeienartige Hirtenweise an, das Horn nimmt sie auf und die Violinen bringen das Thema zur vollen Entfaltung. Mit dieser einfachen Melodie im Volkston entwickelt Beethoven seine große Kunst des Abwandelns und Variierens, um einen breit dahinströmenden, von frohen und dankbaren Gefühlen erfüllten Hymnus auf die Herrlichkeit der Natur zu singen.
Lisa Wellisch
Die junge Bayreuther Pianistin debütierte nach dem Abitur als Solistin mit Mozarts „Jeunehomme-Konzert“ zum Auftakt des deutschen Mozart-Fests 2008. Seither gab sie zahlreiche Solo-/Lied-und Kammermusik-Abende in vielen Städten Deutschlands (u.a. Stadthalle Bayreuth, Orangerie Darmstadt, Villa Musica Mainz), in Österreich, Italien, dem Oman und der Schweiz. Neben dem Besuch des musischen Gymnasiums studierte Lisa Wellisch zunächst Klavier als Jungstudentin in der Klasse von Prof. Michael Wessel an der Bayreuther Hochschule f. ev. Kirchenmusik. Von 2006 – 2013 studierte sie an der Musikhochschule Stuttgart Schulmusik und Klavier als künstlerisches Hauptfach (Klasse Prof. Hans-Peter Stenzl) mit Schwerpunkt Lied/Kammermusik. 2013-2015 absolvierte sie ihr Masterstudium Klavier Solo bei Prof. Gilead Mishory an der Freiburger Musikhochschule (Unterricht in Liedgestaltung erhielt sie parallel bei Prof. Matthias Alteheld). Im Frühjahr 2015 wurde sie mit der Sopranistin Maja Lange in die Liedklasse von Hartmut Höll und Mitsuko Shirai an der Musikhochschule Karlsruhe aufgenommen.
Sie ist Stipendiatin der Yehudi Menuhin Stiftung „Live Music Now“, dem Richard-Wagner-Verband (2012) und der Villa Musica Rheinland-Pfalz 2011. Anlässlich des Liszt-Jahres 2011 und des Wagner-Jahres 2013 spielte sie mehrere Konzerte mit eigenen Einführungsvorträgen bei Steingraeber & Söhne Bayreuth auf dem dortigen „Liszt-Flügel“. Zu ihren Lied-Partnern gehören u.a. die ukrainische Sopranistin Olena Tokar (1. ARD-Preisträgerin 2012), die Sopranistin Maja Lange, und die Sopranistin Jihyun Cecilia Lee.
Uwe Reinhardt
leitet den Orchesterverein Öhringen seit 2010. Prof. Dr. med. Dr. phil. U. Reinhardt ist Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Innere Medizin des Hohenloher Krankenhauses mit den Spezialgebieten Hämatologie, Onkologie und Gastroenterologie. Parallel zum Medizinstudium studierte er an der Dresdner Musikhochschule Orchesterdirigieren und Klavier und ist seit seinem Staatsexamen und künstlerischem Diplom als Orchesterleiter, Gastdirigent, Pianist und Komponist vielfältig musikalisch aktiv. Die intensive Beschäftigung mit berufsbedingten Erkrankungen von Musikern führte ihn zur Gründung eines Instituts für Musikmedizin an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden. Seit 2012 unterrichtet er als Gastprofessor an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.
 Die in Pegnitz geborene Bratschistin Anna Hösl erhielt ihren ersten Geigenunterricht im Alter von sechs Jahren. In den darauffolgenden Jahren folgten mehrere Preise bei „Jugend musiziert“. Nach dem Abitur am Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium in Bayreuth studierte sie zuerst Violine IGP an der Kunstuniversität in Graz bei Prof. Anke Schittenhelm, bevor sie zur Viola wechselte. Von 2012 bis 2014 studierte sie bei Fabio Marano an der Hochschule für Musik in Karlsruhe, wo sie erfolgreich ihren Bachelorabschluss absolvierte. 2014 wurde sie in die Konzertfachklasse von Prof. Thomas Selditz an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien aufgenommen. Sie wirkte in zahlreichen Orchesterprojekten mit, unter anderem im Festspielhaus Baden Baden mit dem Nederlands Dans Theater, beim Festival junger Künstler Bayreuth, im Jungen Tonkünstlerorchester, Young Generation Orchester, dem Norddeutschen Symphonieorchester und war stellvertretendeStimmführerin im Webern Symphonie Orchester Wien. Mit dem 2012 gegründeten Streichtrio Arcata gibt sie unter anderem im Rahmen der Yehudi Menuhin Stiftung „Live Music Now“ Konzerte. Konzertreisen und Orchestertourneen führten sie in Länder wie den Libanon, die Ukraine und nach China. Wichtige musikalische Impulse erhielt sie in Meisterkursen bei Prof. Anke Schittenhelm, Fabio Marano und Prof. Hariolf Schlichtig.
Die in Pegnitz geborene Bratschistin Anna Hösl erhielt ihren ersten Geigenunterricht im Alter von sechs Jahren. In den darauffolgenden Jahren folgten mehrere Preise bei „Jugend musiziert“. Nach dem Abitur am Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium in Bayreuth studierte sie zuerst Violine IGP an der Kunstuniversität in Graz bei Prof. Anke Schittenhelm, bevor sie zur Viola wechselte. Von 2012 bis 2014 studierte sie bei Fabio Marano an der Hochschule für Musik in Karlsruhe, wo sie erfolgreich ihren Bachelorabschluss absolvierte. 2014 wurde sie in die Konzertfachklasse von Prof. Thomas Selditz an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien aufgenommen. Sie wirkte in zahlreichen Orchesterprojekten mit, unter anderem im Festspielhaus Baden Baden mit dem Nederlands Dans Theater, beim Festival junger Künstler Bayreuth, im Jungen Tonkünstlerorchester, Young Generation Orchester, dem Norddeutschen Symphonieorchester und war stellvertretendeStimmführerin im Webern Symphonie Orchester Wien. Mit dem 2012 gegründeten Streichtrio Arcata gibt sie unter anderem im Rahmen der Yehudi Menuhin Stiftung „Live Music Now“ Konzerte. Konzertreisen und Orchestertourneen führten sie in Länder wie den Libanon, die Ukraine und nach China. Wichtige musikalische Impulse erhielt sie in Meisterkursen bei Prof. Anke Schittenhelm, Fabio Marano und Prof. Hariolf Schlichtig. Ian Galli-Heckmann erhielt seinen ersten Violinunterricht nach der Suzukimethode in seiner Heimatstadt Paris. Im Alter von 6 Jahren wurde er von dem russischen Solisten Joseph Rissin entdeckt und zu seinem Pariser Kollegen Nejmi Succari empfohlen. Unter seiner Leitung belegte er schon sehr früh Erfolge in nationalen und internationalen Wettbewerben. Nach seinem Abitur, das er an der Purcell School of Music London absolvierte, studierte er als Foundation Scholar am Royal College of Music in London unter Yossi Zivoni und Ani Schnach, später an der Hochschule für Musik Karlsruhe bei L. Breuninger. Derzeit schliesst er sein Masterstudium an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig unter Kathrin ten Hagen ab. Über die Jahre war er als Orchestermusiker sowie Solist vielseitig aktiv mit Auftritten in Frankreich, Deutschland, England, Schweiz, Polen, Italien, Lichtenstein.
Ian Galli-Heckmann erhielt seinen ersten Violinunterricht nach der Suzukimethode in seiner Heimatstadt Paris. Im Alter von 6 Jahren wurde er von dem russischen Solisten Joseph Rissin entdeckt und zu seinem Pariser Kollegen Nejmi Succari empfohlen. Unter seiner Leitung belegte er schon sehr früh Erfolge in nationalen und internationalen Wettbewerben. Nach seinem Abitur, das er an der Purcell School of Music London absolvierte, studierte er als Foundation Scholar am Royal College of Music in London unter Yossi Zivoni und Ani Schnach, später an der Hochschule für Musik Karlsruhe bei L. Breuninger. Derzeit schliesst er sein Masterstudium an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig unter Kathrin ten Hagen ab. Über die Jahre war er als Orchestermusiker sowie Solist vielseitig aktiv mit Auftritten in Frankreich, Deutschland, England, Schweiz, Polen, Italien, Lichtenstein.